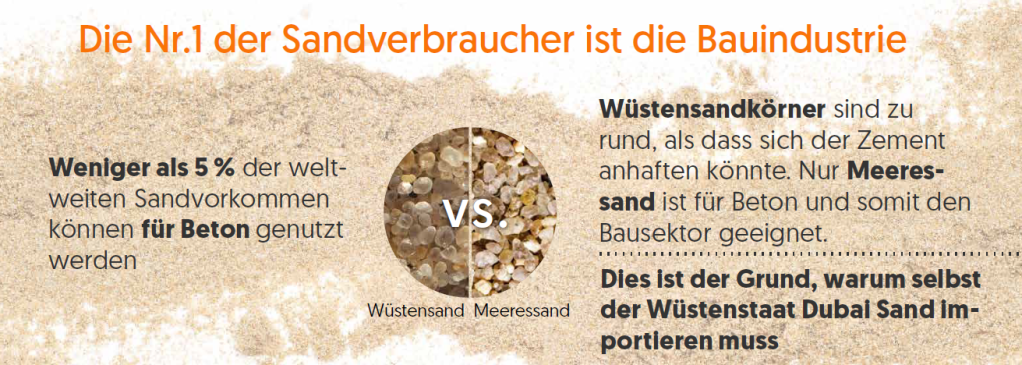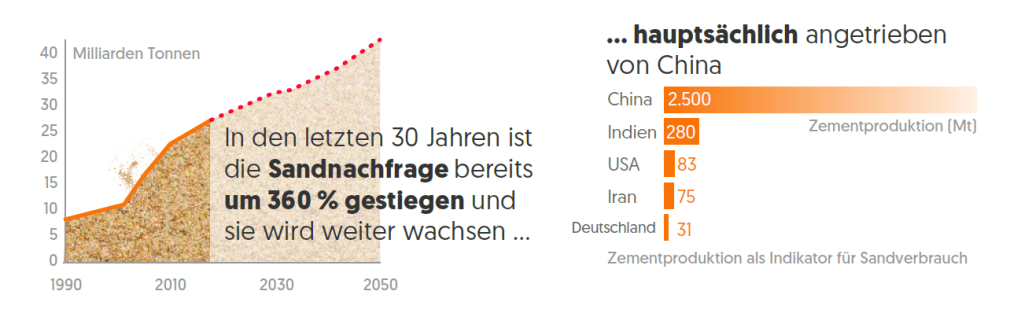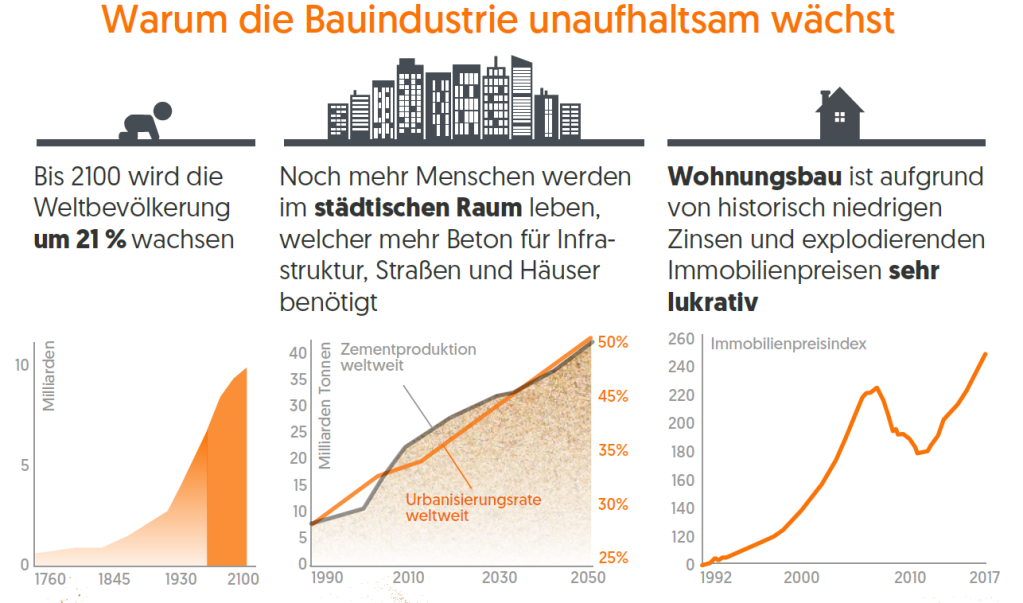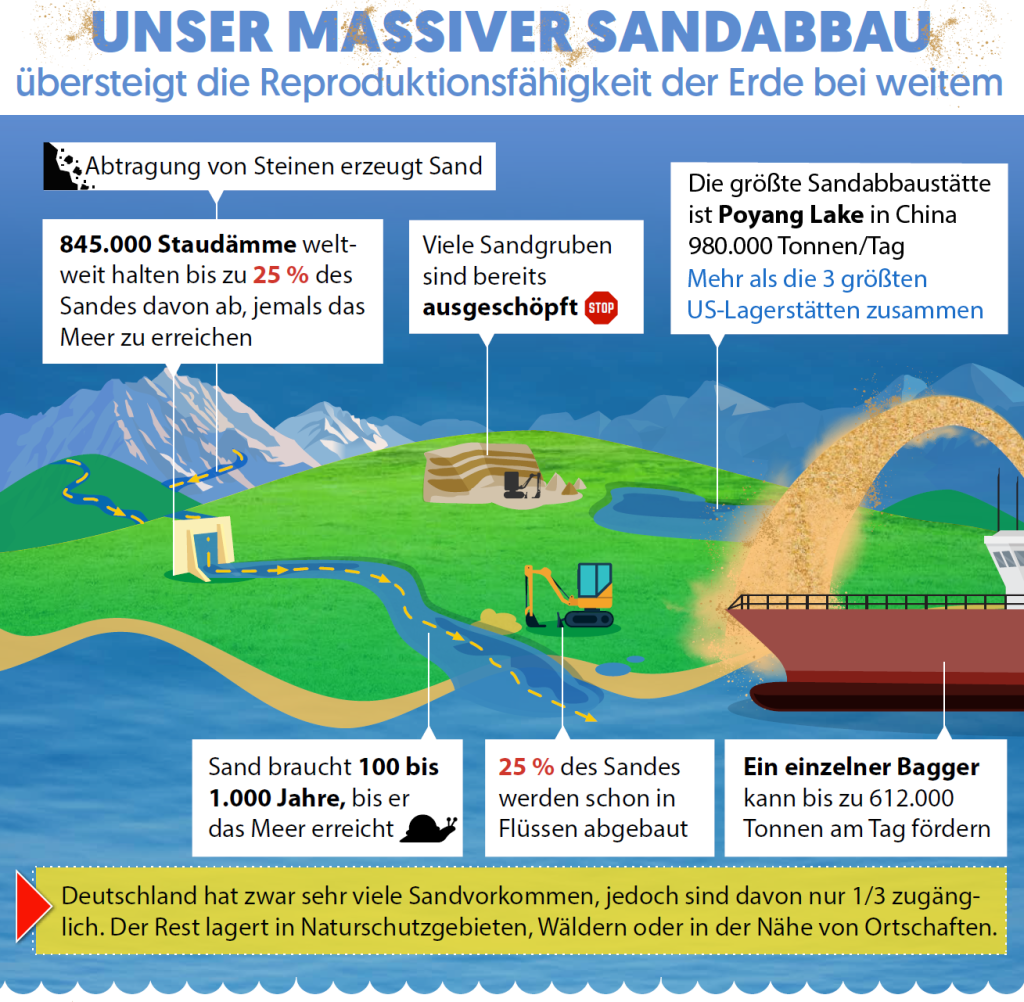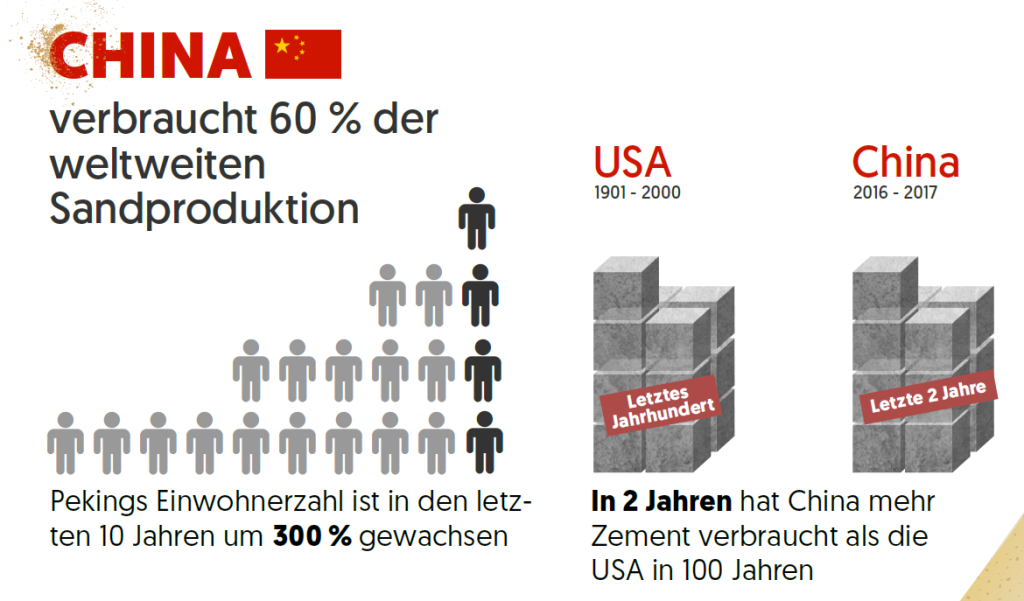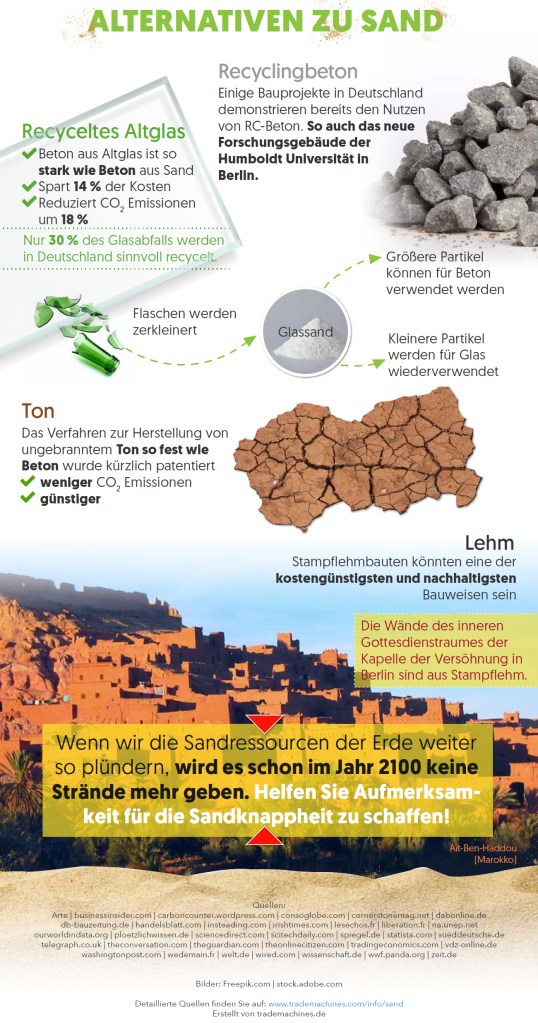Radikal denken und schrittweise handeln
Die Frist zur Unterzeichnung der Petition von Erzieherin Susanne Wiest war bis zum 17.2.2009 verlängert worden – aufgrund der technischen Probleme, die die Petitions-Webseite des Bundestages mit dem Unterzeichner-Ansturm hatte! Bei Erreichen von 50.000 Unterzeichnern hätten sich die Abgeordneten offen mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens auseinandersetzen müssen. Am 16.2. überschritt die Stimmabgabe die 41.000er Marke – letztlich wurde sie von 52.973 Befürwortern mitgezeichnet. Die Anhörung hatte am Montag, den 8. November 2010 stattgefunden. (Ergebnis s. im Netz)
Was waren außer Frau Wiests persönlicher Betroffenheit die allgemeinen Hintergründe?
Seit Jahren bilden Millionen Arbeitslose eine konstante Größe in unserer Gesellschaft. Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit variieren über viele Jahre hinweg zwischen drei und fünf Millionen Arbeitslose. Jährlichen Einfluss auf die genaue Zahl (nicht auf die Dimension) nehmen immer schon nur Konjunkturschwankungen, Änderungen und/oder Anpassungen der statistischen Zählweise oder der EDV-Systeme (Bund/Länder/Gemeinden) oder auch alles zugleich. Nach dem befristeten Bezug von Arbeitslosengeld schauen die Betroffenen in das offene Visier von Hartz IV. Das bedeutet: Offenlegungszwang sämtlicher Spar- und Einkommensverhältnisse; Aufbrauchen des Ersparten bis auf durch heftige Proteste den Politikern abgerungene Zugeständnisse an die Altersvorsorge; eine Bedarfsprüfung auf Hartz IV-Regelsatz-Anspruch und Mietkostenbeihilfe (ohne Stromverbrauch) bis auf den Cent- und Wohnquadatmeter-Nachweis. Nach Zusammenlegung verschiedener Beihilfezuständigkeiten erfolgte dann 2005 die Gleichstellung aller Hilfesuchenden (sogenannte Hartz IV-Gesetzgebung), ob jahrelang berufstätig oder nie, ob hochgebildet oder sonderbeschult, ob 18- oder 55-jährig. Die persönliche Leistungs- und Lebensbiographie spielte und spielt keine Rolle. Verwaltungsangestellte oder –beamte entscheiden, teilen zu oder entziehen das Wort. Die Sozialgerichte wurden und werden mit Klagen überhäuft und sind personell überfordert.
Dagegen war einer aufgestanden und mit ihm wurden und werden es ständig mehr. Er begeisterte immer wieder seine Zuhörer, verblüffte seine Kritiker mit gediegenem wirtschaftlichen Durchblick und menschlicher Offenheit. Er stellte den Menschen in den Mittelpunkt: Der Millardär Götz Werner kämpfte und kämpft für die Hartz IV-Betroffenen und gegen die ungleiche Arbeits- und Einkommensverteilung in Deutschland.
„Dieses manische Schauen auf Arbeit macht uns alle krank. Und was ist denn Hartz IV? Hartz IV ist offener Strafvollzug. Es ist die Beraubung von Freiheitsrechten. Hartz IV quält die Menschen, zerstört ihre Kreativität. … Wir brauchen ein Recht auf Einkommen. Ein Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen“, so Götz Werner.
Ob im Hörsaal, in der Talkshow oder auf einer Podiumsdikussion, persönlich wirkte der Unternehmer, Anthroposoph und Professor ohne Studium, ja ohne Abitur authentisch und kompetent. Hier dachte einer, während er sprach, hier gelang es jemandem, glaubwürdig zu überzeugen.
Prof. Werner ging dabei an die Wurzeln unseres Sozialstaats, der Grund dafür, dass ihm starke Vorbehalte seitens der politischen Zunft entgegengebracht wurden.
Unser sozialstaatliches Denken und Handeln ist eben immer noch in der Tradition Bismarckscher Prägung angelegt, also im Selbstverständnis eines weitgehend binnenräumlichen Wirtschaftens, obwohl davon in dieser Zeit eigentlich keine Rede mehr sein kann. Angesichts der europäisch bis global beeinflussten Sozial- und Wirtschaftsverhältnisse heute ist jeder einzelne Bürger angesprochen, seine Begriffswelt neu zu überprüfen.
Mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens konfrontierte Götz Werner die Politiker und schaltete sich in die öffentliche Debatte ein. Werner appellierte dabei an das eigene Denken eines jeden Einzelnen.
Wir leben in der totalen Fremdversorgung, Selbstversorgung spielt kaum noch eine Rolle. Viele meinen noch heute, sie lebten von ihrer eigenen Leistung, müssten zur Altersvorsorge für ihre eigene Rente sorgen. Tatsächlich leben wir aber immer von der Leistung anderer, wir leisten für andere, und wir müssen damit rechnen, dass andere mit unserer Leistung rechnen. Unsere sozialen Verhältnisse entstammen heute noch aus der Selbstversorgungs- oder Binnenwirtschaft, obwohl wir inzwischen in einer absoluten Fremdversorgungswirtschaft mit globaler Arbeitsteilung leben. Notwendig wären daher Verhältnisse, die nicht nur selbst initiativ sind, sondern neue Initiativen hervorbringen. Unter Arbeit wird gemeinhin Arbeit an den Naturgrundlagen und der Materie, also in der Produktion und in produktionsnahen Dienstleistungen verstanden. Dabei herrscht aber ein riesiger Mangel an „Kulturarbeit“: nämlich Bildungsarbeit, Erziehungsarbeit, Elternarbeit, Sozialarbeit, kurzum – menschenzugewandte Arbeit. Darin geht es nicht etwa um Produktivität, sondern um menschliche Zuwendung; es geht nicht um Sparsamkeit, sondern im Gegenteil um Freizügigkeit; es geht nicht um Einkommens- sondern um Sinnmaximierung. Kulturarbeit ist keine leitungsgebundene Arbeit, sondern bedarf eben der einzelmenschlichen Initiative. Natürlich ließe sich ihr monetärer Wert auch berechnen, wenn man die Einkommen derjenigen zugrunde legte, die nur durch diese Kulturarbeit möglich ist: etwa die der Eltern, während Erzieher deren Kinder in Tagesstätten betreuen. Solche Arbeit ist prinzipiell unbezahlbar, eine Gesellschaft kann sie nur ermöglichen. Das bedingungslose Grundeinkommen soll der Ermöglichung solcher Arbeit dienen und nicht der Arbeitsverhinderung. Es soll wirkliche Arbeitsplätze schaffen und nicht nur Einkommensplätze! Finanziert werden soll das Ganze über eine Erhöhung der indirekten Steuern, insbesondere durch eine kräftige Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Luxusgüter. Und durch Einsparung der Arbeitslosenverwaltung und weiterer Teile bundesdeutscher Behördenapparate, deren Tätigkeit dann überflüssig würde.
Viele Bürger und Politiker, Unternehmer und Wissenschaftler zweifeln. Sie sehen in einer solidarischen Bürgerversicherung eher eine sinnvolle Erweiterung unseres Sozialstaates. Auch wird mehr Eigenverantwortung des Einzelnen im Hinblick auf seine Gesundheits- und Altersvorsorge als kaum zumutbar angesehen. Die Unter- und Mittelschichten, nicht die durch Erbschaft und Herkunft Betuchten, trügen jedenfalls die Hauptlast der Kosten. Auch die Mehrwertsteuer wird als Finanzierungsquelle misstrauisch angesehen, nimmt sie doch keine Rücksicht auf die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Bürger, z. B. kinderreicher Familien, deren Konsumgüterbedarf immer recht hoch ist. Zuguterletzt: Es scheint, dass für die Mehrheit der Bevölkerung die Bedürftigkeit Einzelner und die Frage eine Rolle zu spielen scheint, warum jemand in eine Notlage geraten ist. Hierzu werden mit Recht Antworten und politisches Handeln erwartet. Und es scheint sich wohl leider auch eine Jahrhunderte alte Grundhaltung wieder im leise und laut geäußerten Wort auszudrücken: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.“ Fällt das nicht auf diejenigen zurück, die selbst nicht arbeiten, sondern ihr „Geld arbeiten lassen“?
Gefällt mir Wird geladen …